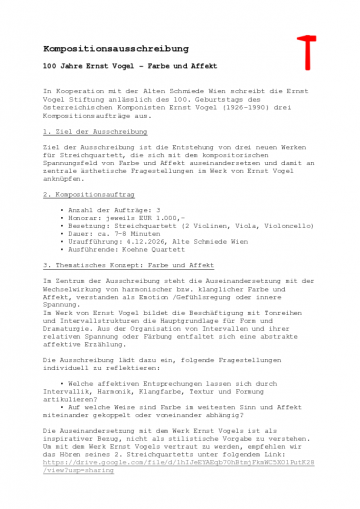blog
Wiener Vorlesung zur Literatur: »Je cherche la verité«. Ein poetologisches Making-of des Romans Regenbogenweiß
Die Autorin unternimmt dabei eine Spurensuche zu den Beweggründen und philosophischen Denkmustern ihres 2022 im Droschl-Verlag erschienen Romans Regenbogenweiß. Zentrale Begriffe sind für sie u.a. »Wahrheit«, im Sinne eines dem jeweiligen Sachverhalt angemessenen Verständnisses, und »Gleichheit« als notwendige Voraussetzung »für die Idee universellen Glücks«.
Einen Auszug aus der Poetikvorlesung können Sie nun im Blog der Alten Schmiede nachlesen. Der vollständige Text ist soeben in der aktuellen Ausgabe (Nr. 184) der Zeitschrift wespennest erschienen.
Angabe
Über diese Betrachtung der Wirklichkeit als Beziehungsgeflecht bin ich letztlich auch auf jenen Begriff gestoßen, der – für mich – am Ende das Zentrum (vielleicht das leere Zentrum, die leere Mitte) des Romans geworden ist: die Gleichheit. Wenn man Glück nicht als eine rein individuell-subjektive Angelegenheit begreift, sondern so wie Badiou, philosophisch, wird Gleichheit zur notwendigen Voraussetzung für die Idee universellen Glücks: Erst wenn alle die gleichen Möglichkeiten haben, glücklich zu sein, ist die Idee von Glück philosophisch verwirklicht. Denn es gibt logisch keinen Grund, weshalb manche eine größere Chance auf Glück haben sollten als andere.
Zu verwirklichen wird diese Idee universellen Glücks natürlich niemals zur Gänze sein, denn es gibt Ungleichheiten, gegen die wir Menschen machtlos sind, die naturgegeben sind, aus dem blinden Zufall resultieren. Aber all das, was an ungleicher Verteilung von Glücksmöglichkeiten aus Konzepten resultiert, die sich Menschen ausgedacht haben, könnte theoretisch beseitigt werden. Das, dachte ich, könnte, müsste unser aller Ziel sein – danach zu streben, dass unsere gemeinsame Heimat, der Planet Erde, eine einzige große Weltgesellschaft wird, die das Fundament ist, auf dem alles Einzigartig-Individuelle sein volles Potenzial entfalten und damit Glück finden kann.
Das wollte ich in meinen Text einschreiben als Gedanken, und zugleich auf einige wichtige Bezogenheiten und Konzepte hinweisen, die wir heute zwar als selbstverständlich empfinden, die aber, so wie sie sind, fallen müssten, um Gleichheit auf diesem Planeten zu ermöglichen und somit auch eine universellere Vision von Glück. Konkret hinweisen wollte ich auf das Konzept der Nation – mit ihren willkürlichen Grenzen, ihrer Landeswährung, ihren Steuern und Gesetzen – genauso wie auf unsere nach wie vor religiöse Unterteilung der Zeit, die den Jahreslauf organisiert, oder die Absurdität des Geldes als alles dominierende Konzept, Wert zu bemessen. Zugleich wollte ich versuchen, an das zu erinnern, was anders als diese von Menschen erdachten Konzepte unser Leben auf diesem Planeten fundamental bestimmte: auf die Natur und ihre Gesetzmäßigkeiten, vor allem auf das grausame Faktum des Todes, der Sterblichkeit, das das einzige ist, das wirklich für alles Lebendige gleich gilt. Was entsteht, vergeht. Wer geboren wird, der stirbt.
Gleichheit wurde so für mich zum Scharnierbegriff zwischen den Begriffen Zeit (oder Tod) und Glück: Gleichheit als logische Voraussetzung für eine gesellschaftliche Glücksvision. Und die Zeit als der notwendige Gleichmacher von uns allen, als die eine Macht, die größer ist als wir, die uns unsere eigene Kleinheit und Unbedeutendheit lehrt.
Gleichheit ist insgesamt ein besonders schwieriger abstrakter Begriff, weil er – für mich – wesenlos ist. Man kann ihn kaum phänomenologisch betrachten, glaube ich. Gleichheit ist ein mathematischer Begriff – anders als Freiheit oder Brüderlichkeit. T1 = T2, so formuliert man eine Gleichung. Zwei Individuen, deren charakteristischstes Merkmal es ist, sich voneinander zu unterscheiden, ungleich zu sein, lassen sich damit per se nicht gleichsetzen. In Bezug auf die Regelung unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens auf diesem Planeten müsste also etwas Paradoxes gelingen: unser aller Verschiedenheit einzubetten in einen gesellschaftlichen Rahmen, der sie trägt und schützt; der Individualität nicht auslöscht durch Uniformität, Individuen nicht zu Gruppen zusammenfasst, die fundamental gegeneinander ausgespielt werden, und auch nicht so sehr verschwindet, dass das Zusammenleben vollkommen regellos wird. Konsequent davon ausgehend gedacht, müsste sich die Weltordnung von heute in vielerlei Hinsicht vollkommen wandeln.
Eine neue Welt wollte ich mit Regenbogenweiß aber noch nicht entwerfen. Ich wollte die mentale Haltung zeigen, eine Art paradoxes Denken, das vielleicht den Weg zu einer neuen Weltordnung weisen könnte, das jedenfalls eine mentale Ergänzung werden könnte zu dem einseitigen, omnipräsenten, dominanten kapitalistischen Sinnkonzept, das – wenn man die Weltverfasstheit der letzten Jahre betrachtet – zu einer Serie von immer noch schlimmeren Krisen geführt hat und immer weiter und schneller in Richtung Apokalypse treibt.
Sich als kleiner Teil der allumfassenden Natur begreifen und sich selbst verbunden fühlen mit allen anderen Menschen in einem Streben nach der Idee universellen Glücks, das könnte jenes mentale Gegengewicht werden, das der Kapitalismus, der seinen Fokus so sehr auf das einzelne Individuum legt und auf das Geld, das eine rein menschliche Erfindung darstellt, nichts Naturgegebenes hat, so dringend braucht, so dachte ich.
Natürlich ist das alles gedanklich nicht neu oder originell, was ich bis hierher erzählt habe. Und entweder klingt es völlig unverständlich und versponnen oder aber ganz und gar selbstverständlich, weshalb es dann unnötig erscheint, es so lang und breit zu erklären. Ich bin über Jahre mental genau zwischen diesen beiden Polen hin- und hergesprungen. Es erschien alles letztlich so banal – eben weil es für mich logisch war. Zugleich erschien es absolut versponnen – zu paradox, zu abstrakt, zu theoretisch, jedenfalls zu illusorisch angesichts der Welt, so wie sie ist.
Vor allem schien es mir defizitär, kein klares Thema zu haben, sondern «nur» einen Modus des Lebens, den ich zeigen wollte, eine alternative Gedankenwelt zu jener, der der Mehrheitslifestyle dieser Gesellschaft folgt. Wir sind es heute gewohnt, Bücher zuallererst auf ihr Thema hin zu untersuchen. Aber darin offenbaren sich – so habe ich mir das immer wieder erklärt – letztlich doch auch kapitalistische Prinzipien. Wir müssen sofort wissen, worum es in einem Text geht, was er uns sagen will, damit wir entscheiden können, ob er relevant ist für uns, ob er uns nützt. Heute bin ich beinahe stolz darauf, dass Regenbogenweiß kein spezifischeres Thema hat als die Auseinandersetzung mit der sehr allgemeinen Frage, wie wir leben sollen.
Ab einem gewissen Zeitpunkt dachte ich, ich schreibe einen Roman, der wie Lyrik funktioniert. Und das hat mich beruhigt. Von der Lyrik erwarten wir uns nach wie vor am wenigsten eine spezifische Thematik. Sie ist immer noch zuständig für die letzten Fragen und für das Leben in der Welt an sich, für alles Metaphysische also. Vielleicht ist sie gerade deshalb auch heute so marginalisiert. Und dieser Gedanke war für mich während meiner Arbeit an Regenbogenweiß oftmals tröstlich: Wenn Lyrik so sein kann, dann warum Prosa nicht?
© Text: Friederike Gösweiner
mit freundlicher Genehmigung durch wespennest. zeitschrift für brauchbare texte