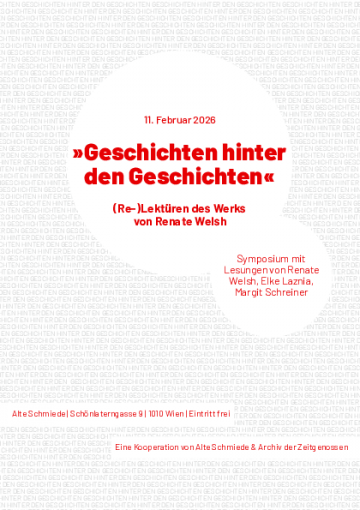blog
Mieze Medusa: Weißt du, Wien ...
Weißt du, Wien ...
Weißt du, dieses Wien war immer schon groß.
Eine Stadt in Übergröße.
Überaus viele Menschen übereinander gestapelt.
Ein Wirrwarr von Sprachen.
Kein Turm zu Babel, eher ein brabbelndes, brodelndes, bisschen grantelndes Übereinanderschichten
von viel zu vielen Gesichtern …
Wer schafft denn die Arbeit, Frau Minister AD?
Wie war denn das damals, als die Prachtbauten am Ring entstehn?
Von Massen erbaut in 15-stündigen Arbeitstagen, jeden Tag die Woche, jede Woche im Jahr.
»Komm nach Wien! In den Ziegelwerken am Wienerberg gibt’s Arbeit!«
Und niemand wird dich nach Deutschkenntnissen fragen.
Du hast einen Platz zum Schlafen, ja! Sei froh!
Aber im Massenlager auf Holzpritschen, elendes altes Stroh,
Körper an Körper,
Menschen wie du und ich, aber anders …
Menschen wie du und ich, aber damals …
und als die Massen sich erheben, fragt der überraschte Kaiser lapidar: »Ja, dürfen’s denn das?«
Bisschen später, weißt du, war’s so:
Wien war damals wie die Welt heute.
Zu viele Menschen auf einem begrenzten Planeten, der sich um sich selbst dreht.
Die Wenigen haben urviel. Die andern wissen kaum, was essen und wie überleben.
8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Schlaf und 8 Stunden Freizeit,
das war damals hier und ist heute dort utopisches Reden.
Und wenn du dich traust, dich überwindest …
Wenn sich ein paar zusammentun, um die letzte Bastion zu stürmen …
Der kaiserliche Thron schwankt schon im Sturm der neuen Zeiten,
aber sonst hat sich nicht so viel geändert.
Außer, dass die Zeiten hart, härter, am Härtesten sind.
Das Proletariat hackelt und murrt und fragt sich, warum die Wenigen immer die Stärkeren sind?
Und es versammelt sich in der Vorstadt!
Das andere Wien trifft sich am Abend im Salon, im Theater oder zum Konzert.
»Was geben sie denn heute? Ach, den Wallenstein? Schön, schön …«
Ein paar Leute fragen sich, ob Schönheit nicht schöner ist, wenn sie mit allen geteilt wird?
Und so wird bei Versammlungen nicht nur der Klassenkampf erörtert, nein!
Es wird von den Schönheiten der Welt
(und mit Welt ist gemeint: Wien)
(und mit Wien ist gemeint: die Wiener Theater und Konzerthäuser)
erzählt.
Es wird geredet, gelesen und gezeigt, dass es sogar noch Schöneres gibt als Schnapskarten und dumpfige, rauchige stinkige Wirtshauslokale.
Nichts gegen dumpfige, rauchige, stinkige Wirtshauslokale.
In Wien gibt’s immer noch dumpfige, rauchige, stinkige Wirtshauslokale.
Aber auch das ändert sich grade, endlich.
Weißt du, die Welt wird nur besser, wenn man sie besser macht.
In dumpfigen, rauchigen, stinkigen Wirtshauslokalen hockt das Volk
und bildet sich (was ein): Was Einzelne nicht allein schaffen, schaffen wir vereint!
Und immer das Heben nach oben!
Und immer das Streben nach Licht!
Und immer das Brodeln, Reden und Toben in bodennaher Schicht.
»Der Arbeiter muss, schon um seiner Weltanschauung willen, für das Neue, das in die Zukunft weist, kämpfen. Er darf daher keineswegs zeitgenössische Musik von vornherein abweisen«, sagt Paul A. Pisk.
»Ja schon«, sagt mein bisschen trotziges Ich, »aber, really, Zwöfltonmusik?«
Karl Kraus kritisiert.
Natürlich kritisiert Karl Kraus!
Karl Kraus kritisiert den Zugang der Partei zur Musik, weil der ist bürgerlich und elitär.
Ich wollt so gern das Zitat suchen, aber die Wahrheit ist, ich hab Angst vorm Kraus’schen Gesamtwerk, weil: einerseits ist’s sooooooo lang und andererseits ein bissi elitär.
Ein anderer sagt: Immer nur in die Sinfonie! Was ist falsch am Volkslied?
Und Jazz ist sooo bürgerlich!
Und Kino, Radio, Fußball, ja hör mir auf!
Und Jura Soyfer schreibt und tritt jeden Tag auf in einem Theater mit genau 49 Zuschauern – ausverkauft.
Weil ab 50 Plätzen brauchte man eine Konzession und das heißt Packeln mit der Macht.
In der Freizeit schreibt er an einem Roman »So starb eine Partei« (in den 30er Jahren).
Und am Abend deklamiert er:
»Dass wir Hunger haben, ist nicht wichtig,
Nebensache, dass wir betteln gehen,
Unsere Klagen weist man ab als nichtig,
Hauptsache: Die Ordnung bleibt bestehen.«
Weißt du, dieses Wien war immer schon umkämpft.
Gemütlicher Austragungsort von allerhand Grabenkämpfen.
Weißt du, Zwölftonmusik ist wie Abstrakte Malerei,
um sie zu verstehen, muss man wissen, was davor war.
»Es braucht das konsequente Vermitteln musikalischen Grundwissens von Bach bis Beethoven«,
so ein Berufener von damals.
Und dann basteln wir vereint und solidarisch weiter an der Zukunft, also an der Moderne.
»Aber!«, so eine leise, verzagte Stimme in meinem Hinterkopf, »so zementiert man den Kanon, in dem wir nicht vorkommen, doch ein!«
Trotzdem rührt mich das Bild von den Transportarbeitern, die trotz Angst und Selbstzweifel in Arbeitskleidung, schweren Stiefeln, den verdepschten Hut in der Hand, Seite an Seite mit ihren Frauen den Musikvereinssaal betraten.
Einigen Kutschern, so hört man, war die aufgerollte Schürze herab auf die Oberschenkel geglitten …
Wie wir rütteln an den letzten Bastionen!
Sie hörten, so Augenzeugen, mit großer Aufmerksamkeit zu, an manchen Stellen wurden sie unruhig, so dass man merken konnte, »wie sehr die Musik auf sie wirkte«.
Weißt du, es ist ja wirklich die Frage, was wir wollen:
Die Leut zur Kunst erziehn,
oder die Kunst aus den Leuten ziehn.
Stimmt schon. In der Hochkultur trifft sich die Macht zum sich gegenseitig auf die Schulter Klopfen. Es ist schon wichtig, dass wir dort auch sind.
»Was geben sie denn heute, ach, die Jelinek, schön, schön!«
»Die Winterreise?«
»Ja.«
»Wer singt heute die Schubertlieder? Jan Plewka? Das klingt aber schon sehr nach Rock, naja, wer’s mag.«
Weißt du, irgendwie dreht sich alles im Kreis.
Was keineswegs heißt, alles bleibt gleich.
David Josef Bach fordert 1922 »die Überwindung der Elitenkultur«.
Damit meint er, glaub ich, dass es falsch ist, wenn der Zugang zur Hochkultur eine Frage von Geld und korrekter Kleidung ist. Damit hat er, denk ich, Recht. Aber ob es reicht, wenn man den Kanon erst auswendig lernt, dann ein Kapitel dazu schreibt und ihn weitergibt?
Chimamanda Adichie warnt 2009 in einem TED-Talk davor, Leben auf eine einzelne Geschichte zu reduzieren. Damit hat sie sicher Recht, denk ich. Sie sagt: Unsere Leben, unsere Kulturen bestehen aus vielen sich überlappenden Geschichten.
Weißt du, Zwölftonmusik will, dass alle Tasten des Klaviers gleich viel wert sind.
Im Reich der Werte fragt man nicht nach der technischen Betroffenheit.
Weißt du, je weniger man die Zwölftontechnik »merkt« umso besser für die Komposition.
Weißt du, Gestalten sind komplexe Gebilde, das Wahrnehmen ist das Allergewöhnlichste, doch beim Beschreiben kommt man gelegentlich in Verlegenheit.
Weißt du, den Kanon kritisch zu hinterfragen, heißt nicht, dass du Goethes »Faust« nie wieder lesen darfst …
Weißt du, wir alle sind Menschen wie wir, aber anders.
Bald sind wir Menschen wie wir, aber damals.
Wie wir Geschichten und Lieder komponieren, wie wir erzählen, das ist lernen an, aus und mit der Geschichte.
Text © Mieze Medusa