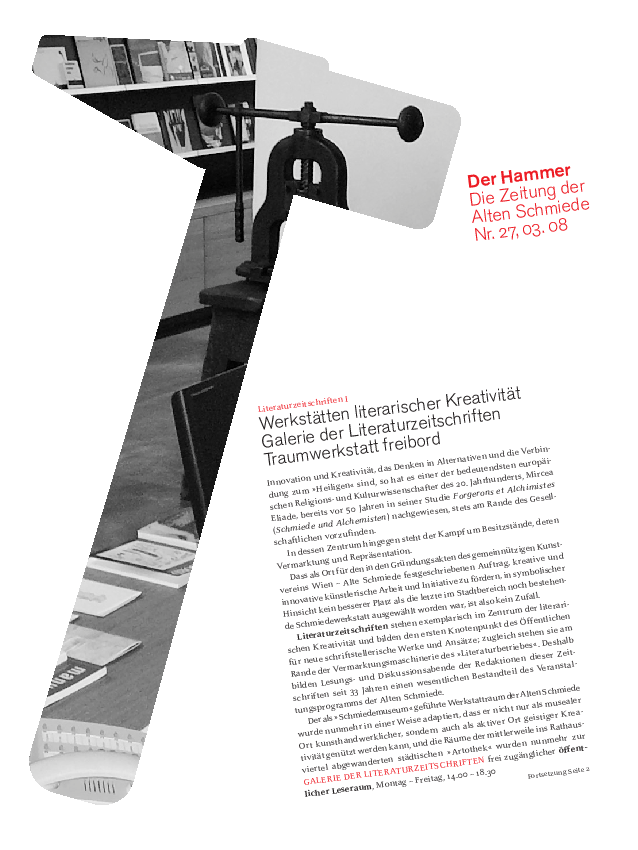blog
PMS: Postmigrantische Störung
Kaśka Bryla, die selbst zwischen Wien und Warschau aufwuchs, schreibt im Vorwort:
»Aus postmigrantischer Perspektive ist Migration ein Prozess, der unsere Gesellschaft wesentlich gestaltet, mitunter durch jene, die selbst nicht mehr migriert sind, aber den Migrationshintergrund ihrer Eltern als persönliches Wissen und kollektive Erinnerung einbringen und einfordern.
Dieses Wissen ist oftmals, wenn nicht sogar durchgängig, mit Scham, Schuldgefühlen und Wut belegt.
Scham über die Hilflosigkeit der Eltern in Anbetracht des Sprachgefälles und der damit erlebten Demütigungen; Schuldgefühle, diesen Demütigungen als Kind nichts entgegengesetzt, sie womöglich mit der eigenen Abgrenzung noch verstärkt zu haben; und schließlich die daraus resultierende Wut, die sich in der gewonnenen Sprachbeherrschung Bahn bricht und eine Rückbesinnung auf die Solidarität mit den Eltern erlaubt«.
Trotz der Auseinandersetzung mit diesen Perspektiven und Erfahrungen wäre es verfehlt, die Texte unter dem Begriff »Migrationsliteratur« zu subsumieren – den die Autor*innen als »Subkategorie der Betroffenheit(sliteratur)« klassifizieren: »Wir wissen, dass alles, was vor die Literatur gestellt wird, aus ihr herausfällt. Betroffenheit hin oder her. Betroffenheit bewirkt Mitgefühl und Mitgefühl selten Achtung«, wird in der Vorrede mit der für die Zeitschrift charakteristischen Direktheit formuliert.
Was die abgedruckten Texte eint, ist nicht allein die postmigrantische Perspektive, sondern ebenso sehr ihr literarischer Anspruch. Dies zeigt die poetische Reflexion »Häuten« von Irina Nekrasov/a, die den Auftakt bildet, auf eindrucksvolle Weise:
»Wenn die Menschen sich verstreuen, über Jahrzehnte verstreuen, woher dann der Glaube, sie wären alle verbunden? Wir halten uns fest an Gerüchen, und halten uns fest an Geschmäckern. Ich fahre mit dem Fahrrad aus der Stadt und kaufe Berberitzensträucher, weil sie gewachsen sind, wo ich gewachsen bin, und eigentlich stimmt es nicht, und eigentlich stimmt es doch«.
So beschreibt die Autorin in ihrer Bewusstseinsstrom-gleichen Auseinandersetzung mit ›Herkunft‹ ein Gefühl des Dazwischen. Wie »jedem Mythos eine Haut nach der anderen abziehen«, wie zwischen all den heterogenen Erzählungen eine für sich selbst stimmige Wahrheit finden, wenn man »dem großen Erzählten« selbst nicht traut?
Die Haut, in ihrer Ambivalenz als Nähe stiftendes und gleichzeitig trennendes Motiv, spielt auch in T. Nguyễns zwischen Lyrik und Prosa angesiedeltem Text »Schlangenhaut« eine Rolle:
»und plötzlich gehörte mein Körper nicht mir / wir haben uns nicht geliebt wie die anderen / ich habe die Romantik vermisst, das elegante Küssen / ach, was redest du da / ich rede davon, dass mein Körper nicht mir gehört / er war nie hier, mit mir / kennst du die Filme, / wo sie uns nackt rumlaufen lassen und sagen / wir seien Wilde? / so habe ich mich gefühlt«.
Im Beitrag »Dünne Beine« von Serra Nadia reflektiert ein Ich seine Stadtbeobachtungen und -begegnungen, in denen Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen aufeinandertreffen. Auch einer von Mascha Bujanovas Beiträgen schildert eine Begegnung im öffentlichen Verkehrsmittel, in deren Rahmen die erzählende Figur in eine Auseinandersetzung mit einer aggressiven, sich rassistisch äußernden Fahrgesellschaft gerät.
Ähnlich setzt sich ein in Briefform verfasster Text Vân Anhs mit Rassismen im gesellschaftlichen Diskurs auseinander, die gegenwärtig sind, die von den sich Äußernden selbst aber selten reflektiert werden:
»Weißt du noch, wie du am Dienstag gesagt hast, ich könnte Harrys und Chos Kind sein? Cho, gespielt von einer schottischen Schauspielerin mit chinesischen Eltern?
Weißt du noch, wie du mich am Mittwoch gefragt hast, ob ich im Kino war, weil du mich in der Nähe davon gesehen hast und du gelesen hattest, dass ein Film über China läuft?«.
Elena S. steuert der Ausgabe mit ihrem Essay »alleinerziehend« eine von vielen feministischen Perspektiven bei. Beim Nachdenken über die Stereotypen, mit welchen alleinerziehende Mütter und Väter oft zu kämpfen haben, kommt sie zu dem Schluss, dass Erziehung niemals nur von einer einzigen Person geleistet werden kann. Sie ist ein Prozess, an dem unterschiedlichste Personen und Institutionen gewollt und ungewollt beteiligt sind und der obendrein in zwei Richtungen vonstattengeht: »Und die Kinder? Kaum imstande, die Sätze in korrekter Wortstellung zu formulieren, fangen damit an, mich zurück zu erziehen. Nicht weinen, Mama, versuch es nochmal.«
Dies ist nur ein kleiner Einblick in das thematische und formale Spektrum der ersten PMS-Ausgabe, die insbesondere durch zahlreiche genaue Beobachtungen und präzise formulierte kritische Reflexionen im Feld postmigrantischer und feministischer Perspektiven beeindruckt.
Die Zeitschrift steht interessierten Leser*innen in der Galerie der Literaturzeitschriften zur Verfügung.
Text: Lena Brandauer (Alte Schmiede)
* PS – Politisch Schreiben wurde 2015 in Leipzig gegründet und ist zugleich ein Literaturnetzwerk und eine Zeitschrift, die literarisches Schreiben im Rahmen seiner gesellschaftlichen Bedingungen reflektiert.