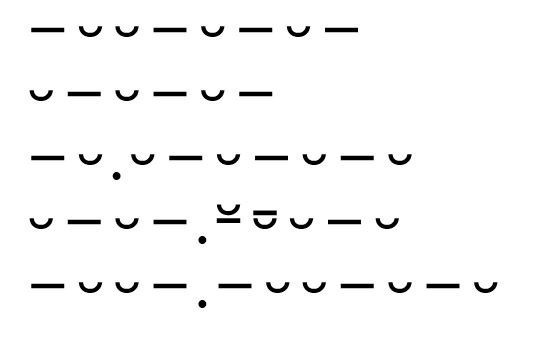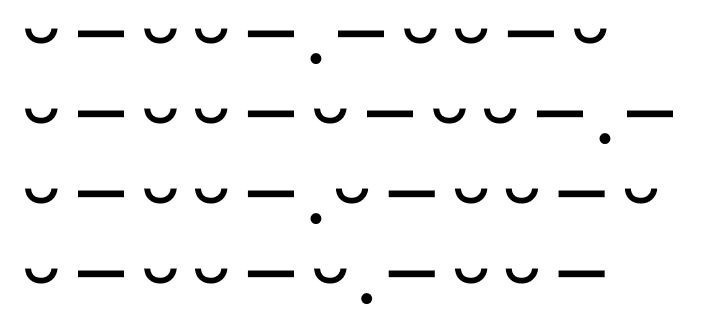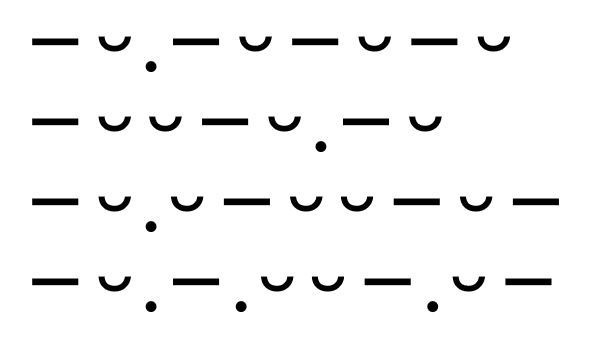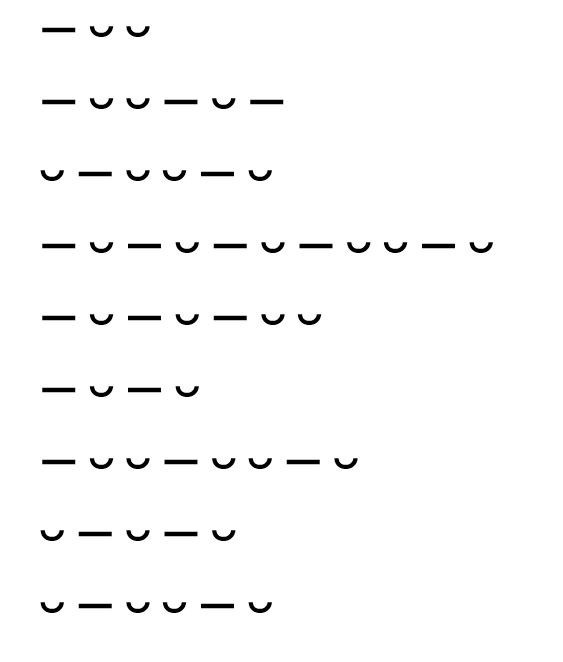autor*innenprojekte
Metrum heute 1/2
Florian Huber/Christian Steinbacher
FÜNF THESEN. Ein Versuch
Wir gehen davon aus, dass Form sich nicht auf das Hervorkehren der Materialität beschränkt und Verse einem konstruktiven Prinzip unterstehen.
Dem Metrum kann dabei eine wesentliche Rolle zukommen, sei es als Raster und Halt, als Barriere und Widerstand, als Störung und als Gestörtes (durch Enjambements, Zäsuren-Mix, Betonungsdifferenzen zwischen Wort- und Versfuß und so weiter).
Wir meinen, dass sich metrische Perioden (auch eigene) neu erkunden, finden und auch erfinden lassen.
Wir denken, dass sich über den Begriff des Metrums gut fassen lässt, was eigentlich Form bedeutet.
»So wird die Dichtkunst zur ›belebenden Kunst‹ in dem Moment, da sie sich ihrer Sprachlichkeit versichert.« (Boris Previšić, Hölderlins Rhythmus, S. 89.)
SPRECHEN ÜBER THESEN (1)
»Werthing. Nųn Si wärden di Sache denn doch aus einander sezen?
Selmer. Nachdäm Si es nämen. Ich wärd’ alles Ueberflüssige weglassen.
W. Was nennen Si überflüssig?
S. Das meiste z. E. fon den poetischen Teorien, di wįr haben.
W. Wen Si nųr nicht zu fįl weglassen.«
Aus dem Beginn von »Fon der Dąrstellung«, in Friedrich Gottlieb Klopstocks Über Sprąche und Dichtkunst. Hamburg: Heroldsche Buchhandlung 1779, S. 244.
Steinbacher.
Klopstocks Selmer unterscheidet daraufhin in der Frage der Darstellung
nicht nur wirkliche Dinge und Vorstellungen, die wir uns davon machen,
sondern behauptet, dass die Vorstellungen von gewissen Dingen so lebhaft
werden können, dass diese uns gegenwärtig und beinah die Dinge selbst
zu sein scheinen, und diese Vorstellungen nennt er »fastwirkliche
Dinge«.
Huber. Ja, aber lässt sich an diesen Einstieg eine weitere Erörterung zu unseren Thesen anschließen?
S. Es
ist offensichtlich, dass bestimmte Metren ein sich steigerndes Tempo
oder eine darauf folgende Ruhe vermitteln können. Derlei Gegebenheiten
sind Versen eingeschrieben, die ja gemacht und eben auch dadurch
›wirklich‹ sind. Abstrakt mag es darum gehen, dass im Fall der Silben
wie auch des ›Tonverhalts‹ markant gewechselt wird, und dieser Wechsel
macht dann das Poem zum Poem, und nicht etwa die dabei übermittelten
Bilder und Gedanken. So bietet der Wechsel als gemachter ja bereits eine
Inszenierung, und dadurch in einem gewissen Sinn sogar ein
»fastwirkliches Ding« (weniger der Empfindung nach, wie es wohl Selmer
bei Klopstock andachte, aber als Spieler auf der Bühne des Gedichts).
H.
Es geht bei den »fastwirklichen Dingen« wohl auch um etwas, das man die
Wirklichkeit des Gedichts nennen könnte. Dass Klopstock etwa mit der
Täuschung ein so geringes Problem hat, wie du einmal betont hast, hat ja
auch zu tun mit seiner Rede von den »fastwirklichen Dingen«.
S. Ist das Gedicht schon das Ding? Oder die Wortbewegung?
H.
Das wäre die Frage. Ich würde aber denken, dass die Wendung
»fastwirkliche Dinge« überhaupt diese Frage erst formulierbar macht und
die Frage danach, was dann eigentlich mit ›Dinge‹ gemeint ist, bezogen
auf die Literatur, provoziert.
S. Jetzt, nachdem wir schon
mehrfach geredet haben, meine ich fast, es ist die Bewegung selbst, die
er als Ding meint, die je eingelöste Bewegung.
H.
Wahrscheinlich geht es um diese Beziehung zwischen der vorgestellten
Bewegung und dem Akt ihrer Einlösung, weil da ja nicht zufällig so viel
die Rede ist von Vorstellungen, und deswegen ist es auch plausibel, das
auf die Bewegung zu beziehen, und auf die Frage danach, wann diese
Bewegung stattfindet, wann sie wirklich oder beinahe wirklich wird, und
für wen.
S. Und Klopstock verwendet häufig die
Möglichkeitsform, was hier nicht unwesentlich ist, weil auch dadurch
bleibt das Ganze ein »fastwirkliches« Ding.
S. Aber um nun
doch noch woanders hinzukommen: Angesichts unserer metrischen Notation
zu dem Gedicht »Gemmen« meintest du, dass Ann Cotten anders betonen
dürfte, als wir es machen. Doch geht es hier nicht nur darum, dass man
das Gedicht, abgesehen von der schwankenden Zeilenlänge, etwa einfach
jambisch und ohne weitere Bewegung ›herunterklopfen‹ könnte, sondern
auch darum, dass die Frage der Deklamation davon betroffen ist.
Schließlich ist doch jede metrische Notation eine Interpretation, und
die kann die Prosodie und die Regeln der Prosodie mehr oder minder
einarbeiten und berücksichtigen oder auch nicht, weil das Metrum ist ein
Idealzustand, wenn man so will, und die Realisierung ist dann erst das
Gesprochene, und das Gesprochene ist dann der Rhythmus, und der muss
sich wiederum an den Regeln der Prosodie des Deutschen orientieren, und
dadurch kommt es zu Widersprüchen, die aber auch Vorteile haben, etwa
wenn man die Silben in eine schwebende Betonung versetzt.
H.
Man könnte aber auch betonen, dass es nicht um die Frage nach Pathos
oder nicht geht, sondern dass die Tatsache, dass man einen Text eben auch mit
Pathos versehen kann, die Qualität des Textes ausmacht. Gerade so, wie
du das erzählt hast, würde man aber annehmen, dass die Poetik
tatsächlich als Leitfaden dient für das Verfassen der eigenen Texte, und
nicht dem eigenen Schreiben nachgeordnet ist, als Akt der Reflexion.
Ich meine, wenn man sagt, das Metrum ist ein Idealzustand, suggeriert
das ja auch, dass es zunächst einmal gilt, im eigenen Schreiben diesem
Idealzustand besonders nahe zu kommen, und das ist wahrscheinlich etwas
anderes als davon auszugehen, dass die Texte entstehen und nachher an
einem Idealzustand gemessen werden.
S. Ich sehe da keinen
Widerspruch, weil ich als Interpret auch eine metrische Notation so
ausrichten kann, dass ich eben mehr die eine oder die andere Seite, also
mehr das von mir jetzt so Gesprochene oder das von mir als idealiter
Darunterliegende in den Blick nehmen kann. Ich weiß nicht, ob das so
relevant ist, weil schlussendlich soll das Gedicht auch
wirkungsästhetisch betrachtet werden und nicht nur von der
Produktionsseite. Und ich könnte die Notation ja voransetzen so wie
Klopstock, aber man kann das auch in einem späteren ersten Schritt der
Interpretation.
H. Da frage ich mich dann aber auch, wodurch
der Text eigentlich zum Gedicht wird, wodurch er erscheint als Gedicht,
oder tut er das nicht notwendigerweise?
SPRECHEN ÜBER THESEN (2)
»Der Fall hat etwas natürliches und leichtes, weil er sich, wie von selbst ereignet; der Sprung hat etwas heftiges und ungestümes, weil er, wie durch eine verborgne Federkraft bewirkt wird.«
Karl Philipp Moritz: Versuch einer deutschen Prosodie. Berlin: Arnold Wever 1786, S. 52.
Steinbacher. Auch
der Satzbau verfügt über Spielarten des Verzögerns, über alle diese
Kunstgriffe, die auch in Richtung Rhetorik weisen und somit wieder weg
von dem, was heute oft als Gedicht verstanden wird, und bei Klopstock
geht das ja fast in eine Rede über, anders als es sich dann Karl Philipp
Moritz erwartet, weil Moritz immer auf eine Harmonie, auf etwas Weiches
abzielt, und interessant ist ja, dass Moritz den zweiten Päon als
besonders harmonisch benennt, während Klopstock ihn unter die ihm
›Stärke‹ ausdrückenden Figuren reiht.
Huber. Das ist
wahrscheinlich auch etwas, das Hölderlin von Klopstock gelernt hat, und
diese Vorstellung von Rhetorik und Rede manifestiert sich auch in einem
unregelmäßigen Gebrauch des Metrums, dem die Moritzʼsche Harmonie
entgegensteht.
S. Die Moritzʼsche Konzeption ist eine, die
auch Disharmonien benennt und darum weiß, dass diese notwendig sind,
aber trotzdem vor allem auf das Harmonische abzielt, es wird dieser
weiche, geschlungene Verlauf bevorzugt gegenüber dem verkantenden,
unentwegten Abbrechen von Verhältnissen und Bewegungen. Die Moderne ist
dagegen gewohnt, abzubrechen.
H. Der Abbruch ist aber nur erkenntlich, wenn im Hintergrund noch eine Form steht, die abgerissen wird.
S. Diese Form, die muss nicht unbedingt tradiert sein, es könnte sogar eine selbstgewählte neuerfundene oder …
H.
Aber sie muss vorhanden, muss sichtbar sein. Und mit der tradierten
Form hat es die Moderne einfach, weil da noch ein bildungsbürgerlicher
Kanon im Hintergrund steht und die Lektüre informiert, während die Frage
heute ist, wie das vonstattengeht, wenn dieser Kanon nicht mehr
vorhanden ist.
*
S. Du hast einmal gemeint, dass im
Barock das Prinzip ›Form sticht Inhalt‹ gilt, doch gerade die Moderne
fokussiert ja auch Fragen der Form, sodass da gar kein gegenteiliges
Prinzip greifen muss.
H. Man könnte aber auch behaupten, dass
in der Moderne die Dichtung nicht mehr weiß, wer wen ›aussticht‹, um
bei dem Bild zu bleiben.
S. So wie generell die Ambivalenz ein
Anliegen der modernen Dichtung ist, und gerade wenn sie tradierte
metrische Muster einbezieht, ist das umso zwingender.
H. Das
ist aber auch abhängig von der Lektürehaltung, und für das, was wir
jetzt erörtert haben, wäre schon eine Frage, für wen sich diese
Neuerkundung erschließt. Ist es eigentlich möglich, mich dieser Form zu
entziehen in der Lektüre, oder lese ich dieses Metrum immer mit? Ist der
Text überhaupt in der Lage, das zu vermitteln?
S. Klopstock
macht es sich da insofern leicht oder auch nicht leicht, indem er nicht
von Ausdruck, sondern von ›Mitausdruck‹ spricht. Das wird also nur ein
Mit-Spieler, dieses metrische Geschehen, auch wenn es für ihn an erster
Stelle steht, denn er reiht die Wortbewegung vor den Wortsinn und diesen
noch vor den Klang. Bei Klopstock ist eine Parallele zur Musik, wie man
sie heute oft zieht, nicht vorhanden, da für ihn die ganze Komponente
Klang wegfällt, die erst später, in der Romantik, dazukommt. Das ist
wichtig, weil diese Abgrenzung zur Musik eine grundlegende ist (während
eine Abgrenzung zum Tanz etwa weniger gegeben ist). Und auch die
Rhetorik kann sich in den Vordergrund schieben, als ergäbe sie Schritte
wie beim Tanz, einem Tanz der Gedanken und Sätze.
H. Auch das Ornamentale kann ja im Zentrum einer Dichtung stehen.
S. Und die moderne Forderung nach einer Ausstellung der Mittel verträgt sich durchaus mit einem Bekenntnis zum Ornamentalen.
*
S.
Interessant auch, dass Hölderlin und Klopstock ein Skandieren
propagieren, das den Unterschied zwischen Spondeus und Trochäus
einebnet, und Moritz nicht, und man müsste das noch einmal
nachzuvollziehen versuchen, wieso das bei Moritz nicht so ist.
H.
Das hat vielleicht auch etwas zu tun mit einem Lapsus, mit dem der
Vortrag doch immer in Zusammenhang steht, dass es letztlich nicht
möglich ist, der Form treu zu bleiben.
S. Und Moritz gestattet den Lapsus nicht, weil er ihm zu weit weggeht von der Prosodie, die das oberste Gebot für ihn ist.
H.
Ja und ich glaube eben auch, dass das ein Gebot ist, das formuliert ist
im Wissen um den Lapsus, um die Unzulänglichkeiten, es ist ein Ideal,
aber ein Ideal, das womöglich nicht erreicht werden kann,
S. oder gar nicht erreicht werden soll,
H. das deswegen aber der Formulierung bedarf,
S.
aber es braucht dieses Ideal, weil es ja einen Widerstand zum Dichten
braucht, auch auf der Ebene der Form, um überhaupt arbeiten zu können.
H. Es braucht das Ideal, um es zu verfehlen.
*
H.
Wahrscheinlich bedarf es eines Hinweises, weil sich die Form nicht mehr
von selbst versteht, und die Tatsache, dass die Form überhaupt genannt
wird, ist schon ein Hinweis auf einen historischen Bruch.
S. Da ist nicht nur ein Verlust, denn dadurch, dass das genannt wird, ist die Tradition ja mit dabei, sie ist ja nur grimmassiert.
H.
Aber die Leserinnen und Leser wissen potenziell nicht mehr darum,
deswegen bedarf es überhaupt des Hinweises, während dagegen die Hörer
und Hörerinnen der Sappho nicht des Hinweises auf die Form bedurften.
S. Das kommt darauf an, Sappho hat ja auch alkäische Strophen –
H.
Das ist nicht die Frage. Der Punkt ist, dass die Hörerinnen und Hörer
es als alkäische Strophe identifizieren, und das kann für moderne
Leserinnen und Leser nicht mehr angenommen werden, und deshalb ist der
Hinweis nicht nur ein Versichern der eigenen Bedeutsamkeit, sondern er
hat eben auch eine Funktion in dem Text.
S. Das ist eine Bezugsgröße, die eingeführt wird, als etwas, mit und an dem man sich voran arbeitet.
H. Aber dadurch, dass sie genannt wird, davor ist das nicht der Fall.
*
H.
Man kann vielleicht auch sagen, dass die Beherrschung der Form alleine
nicht hinreicht, um ein gutes Gedicht zu produzieren. Es bedarf der
Neuakzentuierung, um eine Form belebt erscheinen zu lassen.
S.
Da kann ich natürlich ironisieren, da kann ich aber auch modifizieren,
indem ich andere Zäsuren setze, indem ich Zäsuren gewagter setze, indem
ich aus dem System mittendrunter ausbreche, indem ich auch metrische
Strukturen plötzlich in Prosa hineingebe, ich kann auch sowas machen,
und ich muss nicht diese Strophen genau absetzen gegeneinander, die
alkäische und die sapphische, ich kann sie auch ineinander laufen lassen
etc.
H. Das lässt diese Form der Dichtung ja so didaktisch
erscheinen, dass diese Absatzbewegung gemacht wird und so sichtbar
bleibt im Text.
S. Weil das Gefüge dann zu wenig Gefüge ist.
H.
Wobei es am Ende nicht darauf ankommt, den Leserinnen und Lesern ein
Metrum und eine bestimmte Form zu vermitteln, das bleibt eine
Voraussetzung für das Gelingen des Texts, aber es ist nicht das, was am
Ende der Lektüre dastehen sollte. Es kann nicht darum gehen, aufzumerken
und zu sagen: Ah, eine sapphische Ode!
(Die Passagen wurden kompiliert aus längeren Gesprächen.)