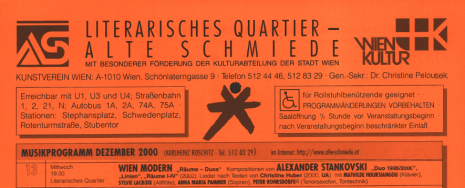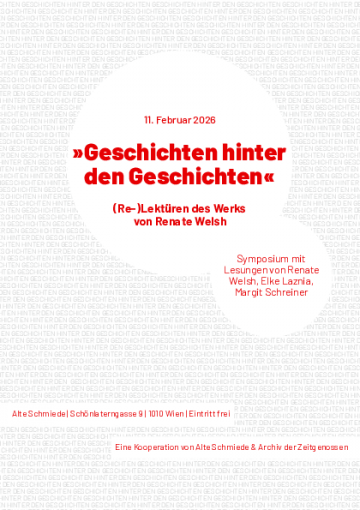blog
StreitBar: Literatur & Resilienz 1/3
Das Buch am Ende der Welt
Von Bettina Balàka
Im Frühjahr 1845 wurden die beiden britischen Schiffe Erebus und Terror für eine große Mission ausgestattet. Die sogenannte Franklin-Expedition – benannt nach ihrem Kommandanten Sir John Franklin – sollte die Nordwestpassage finden und kartografisch erfassen. Neben einem lebenden Äffchen, Musikinstrumenten, einer Daguerreotypie-Kamera und Tonnen an Lebensmitteln wurden auch rund 1.200 Bücher pro Schiff geladen. Dazu gehörte Fachliteratur über technische Themen wie etwa Dampfantrieb, Berichte von vorangegangenen Polarexpeditionen und zahllose religiöse Werke, aber auch Belletristik wie The Pickwick Papers von Charles Dickens oder The Vicar of Wakefield von Oliver Goldsmith. Man rechnete damit, zwei bis drei Jahre unterwegs zu sein und vor allem in den lichtlosen arktischen Wintermonaten ein entsprechendes Quantum an Erbauung, Bildung und Zerstreuung zu benötigen.
Die Expedition scheiterte dramatisch. Weder die beiden Schiffe noch auch nur ein einziger Überlebender kehrten je zurück. Lange Zeit wusste man nichts über ihren Verbleib. 1859, also vierzehn Jahre nach ihrem Start, fand man im tiefen Schnee der im arktischen Norden des heutigen Kanada gelegenen King-William-Insel ein Beiboot, das von der verschollenen Expedition stammte. Es war offenbar mit Hilfe eines Schlittens über das Land geschleppt worden. Die vom Eis eingeschlossenen Schiffe Erebus und Terror hatte man wohl nach dem dritten Winter, als die mitgebrachten Vorräte zu Ende gingen, auf der Suche nach Nahrung verlassen. Zwei Skelette von Besatzungsmitgliedern befanden sich in dem Boot, wahrscheinlich waren sie infolge von Skorbut zu schwach gewesen, um den Marsch fortzusetzen. Der Rest der Gruppe dürfte mit dem nun deutlich leichteren Schlitten weitergezogen sein.
Was hatten diese verzweifelten Männer nun von ihren Schiffen mitgenommen, weil es ihnen nützlich und wichtig erschien? In dem Beiboot waren offenkundig praktische Dinge wie Decken, Lederstiefel und Bärenfelle zurückgeblieben, aber auch eine Meerschaumpfeife, elf silberne, mit Wappen verzierte Dessertgabeln sowie der Roman The Vicar of Wakefield von Oliver Goldsmith.
Was war das für ein Buch, das diesen Männern so viel bedeutete, dass sie es auch im nackten arktischen Überlebenskampf nicht missen wollten? Es war bereits 1766 erschienen, hatte Lord Byron, Sir Walter Scott, Goethe und Herder begeistert und wurde ein Best- und Longseller. Der Ich-Erzähler Dr. Primrose, der Landpfarrer von Wakefield, schildert darin mit formidablem Witz und unerschütterlicher Zuversicht das Schicksal seiner Familie. Durch einen Betrüger verliert er sein Vermögen und nach und nach stellen sich so viele Unglücksfälle ein, dass der gläubige Mann hiobsartige Prüfungen erlebt. Den Trost durch Bücher, das Buch als Lebens-Mittel, thematisiert er dabei immer wieder. Seinen ältesten Sohn muss er nach London schicken, auf dass dieser sich fortan allein durchschlage. Zum Abschied gibt er ihm ein Psalmenbuch mit den Worten:
(…) these two lines in it are worth a million; I have been young, and now am old; yet never saw the righteous man forsaken, or his seed begging their bred.’ Let this be your consolation as you travel on.
Die Tochter Olivia wird von einem adeligen Schurken mittels einer Scheinhochzeit verführt und dadurch, nach den Regeln der Zeit, für immer entehrt. Ihr Vater holt sie heim und tröstet sie:
I (…) showed her that books were sweet, unreproaching companions to the miserable, and that if they could not bring us to enjoy life, they would at least teach us to endure it.
Das Buch ist hier wie ein lebendiges Wesen, ein Freund. Indem es einen Ausschnitt der Fantasie und Erfahrung eines anderen Menschen enthält, ist es ein tragbares Medium der Kommunikation, dazu geeignet, selbst den Einsamsten in eine tröstliche Beziehung zu versetzen. Du bist nicht allein, sagt das Buch, andere vor dir haben schon Ähnliches oder Schlimmeres erlebt, meine Existenz ist der Beweis dafür, dass man all das nicht nur übersteht, sondern oft sogar etwas Gutes daraus hervorgeht: Stärkung, die man weitergeben kann. Die Geschichten, die wir einander erzählen, verbinden uns, sagt das Buch, vielleicht wirst auch du eines Tages deine Geschichte erzählen.
Auf der Suche nach der gefallenen Tochter war Dr. Primrose wochenlang von zu Hause abwesend gewesen und unterwegs überdies von einer schweren Erkrankung aufgehalten worden. Spät nachts kehrt er endlich zurück, doch nur um festzustellen, dass just in diesem Moment sein Haus in Flammen aufgeht. Durch seinen panischen Aufschrei geweckt, können sich seine Frau und die älteren Kinder retten, die beiden jüngsten zieht er selbst aus dem zusammenbrechenden Gebäude, wobei er sich eine schwere Verbrennung am Arm zuzieht.
Alle Wertgegenstände sind zu Asche geworden, aber man hat sein Leben und richtet sich mit Spenden der Nachbarn in einer Hütte ein. Dr. Primrose berichtet:
I read to my family from the few books that were saved, and particularly from such as, by amusing the imagination, contribute to ease the heart.
Amusing the imagination. Hier hat man es nicht mehr mit religiösem Trost zu tun, der dem sich gottgefällig Verhaltenden Belohnung verspricht, sondern mit Erleichterung durch Ablenkung. Das Buch weitet den Geist. Geschichten, die die Fantasie in unterhaltsamer Weise beschäftigen, dienen zur Lockerung der Steine, die dann vom Herzen fallen können.
Wie ein Spiegel im Spiegel greift das Motiv hinaus in die Realität. Die Männer, die sich hungernd und frierend auf King William Island voranschleppten, lasen in einem Buch von einem Mann, der über den Trost durch Bücher reflektiert. Wahrscheinlich las einer von ihnen den anderen vor, so wie Dr. Primrose seiner Familie vorlas, und vielleicht diskutierten sie miteinander über die in dem Roman aufgeworfenen Fragen – im tiefen Schnee, mit erfrorenen Zehen und Fingern, mit eisverkrusteten Bärten. Gelang der Eskapismus, konnte das Buch die Fantasie der Verzweifelten soweit beschäftigen, dass sie das Entsetzliche ihrer Situation zumindest vorübergehend vergaßen? Oder haderten sie mit dem Buch ebenso, wie sie wohl mit ihrem Gott haderten? Gaben ihnen Gott und Buch die Hoffnung auf ein Wunder, auf Rettung in letzter Minute durch jenes Ereignis, in dem Gottheit und literarisches Konstrukt zusammenfinden, dem Deus ex machina?
Manche Inhalte des Romans müssen ihnen seltsam irrelevant erschienen sein, die Tugendhaftigkeit der Töchter beispielsweise, die Frage, ob die Monarchie die beste Regierungsform sei oder ob man sich auf Schusters oder einem richtigen Rappen zur Kirche begeben solle. Anderes wiederum muss ihnen schmerzhaft in Erinnerung gerufen haben, was sie aufgegeben hatten: Das Buch handelt nicht zuletzt von der Bedeutung der Familie, in guten wie in schlechten Zeiten. Sie gibt Trost, selbst wenn rundherum alles den Bach hinunter oder in Flammen aufgeht. Hauptsache, man hat einander, sagt Dr. Primrose. Die Männer im ewigen Eis aber hatten ihre Familien weit hinter sich gelassen. Wie lange die Trennungen im Rahmen der Seefahrt damals dauerten, lässt sich anhand einer Episode aus den Anfängen der Expedition ermessen. Als die Schiffe einen Zwischenstopp vor den Orkney-Inseln machten, baten zwei Matrosen, die von dort stammten, um Landurlaub: Der eine hatte seine Frau seit vier Jahren, der andere seine Mutter seit siebzehn Jahren nicht gesehen.
Ihre Familien hatten die letzten Überlebenden der Franklin-Expedition nicht bei sich, aber sie hatten einander. Vielleicht versammelten sie sich um das Buch, wenn die eisigen Stürme nachließen, und lasen darin und träumten.
Bücher sind Inseln der Ordnung, kleine geregelte Welten inmitten der großen, nie zur Gänze erfassbaren und daher chaotisch scheinenden Welt. Im Krimi befindet sich der Mörder immer innerhalb des Buches, also unter den bereits eingeführten Personen – tatsächlich wäre es ein unverzeihlicher Schnitzer, ließe man ihn erst ganz am Ende quasi aus dem Nichts auftauchen. Ebenso ist in der Liebesgeschichte der oder die zu findende Geliebte bereits im Buch, niemals außerhalb, man kann ihn oder sie nicht im ganzen Heu des Erdballs übersehen, denn diese Stecknadel befindet sich mit Sicherheit im vorliegenden Heuhaufen. In der Literatur hat alles eine Bedeutung, Tschechows Waffe liegt nicht sinnlos herum. Plot Points, Klimax und Peripetie treten zum richtigen Zeitpunkt ein. Die literarische Erzählung ist eine runde Sache. Noch besser wird es im Wohlfühlbuch. Da tut der Tod nicht weh, die Krankheit und das Alter, Trauma und Gewalt, alles wird wie ein Spielzeughindernisparcour mit Schwung überwunden, hopp hopp hopp macht das Pferdchen, das von einer riesigen Hand geführt wird und sich nicht anzustrengen braucht.
Romane sind überschaubar. Das macht sie tröstlich – und anders als das Leben. Die Realität ist ein Gebilde ohne Anfang und Ende, sie wuchert in alle Richtungen und kommt doch selten auf einen grünen Zweig.
In The Vicar of Wakefield geht alles gut aus. Die Liebespaare finden zueinander, finanzielle Probleme lösen sich in Wohlstand auf, die tote Olivia ist gar nicht tot, die Scheinhochzeit war eine richtige Hochzeit. Am Tiefpunkt seines Daseins sitzt Dr. Primrose aufgrund seiner Schulden im Gefängnis, allerdings in einer Zelle, in der er Besuch empfangen darf, und wie auf einer Theaterbühne gehen die Akteure ein und aus. Eine Überraschung nach der anderen stellt sich ein, das Böse wird entlarvt, das Gute aus der Unbeachtetheit herausgeschält und in den Glanz gestellt, und all das lässt der Autor mit solchem Charme und Witz geschehen, dass man ihm die Unwahrscheinlichkeit gerne nachsieht. Mag sein, es ist ein bisschen märchenhaft, aber wer liebt denn nicht ein schönes Märchen.
Für die verlorenen Männer in der Arktis müssen diese wundersamen Wendungen Hoffnungsnahrung gewesen sein. Was der Autor im Buch kann, kann doch auch Gott in der Wirklichkeit? Könnte er nicht Folgendes geschehen lassen: Plötzlich erscheint am Horizont eine Rettungsexpedition, sie nähert sich mit flinken Hundeschlitten. Dann steht man einander gegenüber, unermessliche Freude bricht aus. Bekannte Gesichter sind unter den Rettern, Freunde haben nach den Verlorenen gesucht. Schnell werden die halb Erfrorenen in trockene Decken gewickelt. Man entfacht ein Feuer, um exzellenten Darjeeling von Fortnum & Mason mit Rum und Zucker zuzubereiten. Ein Arzt untersucht alle, verabreicht Zitronensaft gegen den Skorbut, versorgt Wunden und spricht ermutigende Worte. Dann gibt es Essen aus Dosen: Rindfleisch, Karotten, Kartoffeln – der vertraute Duft weht durch die unwirtliche Mondlandschaft der Eisinsel. Nachdem man sie soweit aufgepäppelt hat, werden die Geretteten auf die Schlitten geladen und warm eingepackt zu dem wartenden Schiff transportiert. Einige Monate später in London: tosender Jubel, Medaillen, Ruhm, Ehre, Glück.
All das ist nicht passiert. Und doch kann man sich gut vorstellen, warum man von 2.400 Büchern auf den Expeditionsschiffen ausgerechnet diesen Roman von Oliver Goldsmith – der selbst von Armut, Spielsucht und Krankheit schwer gezeichnet war und nur 46 Jahre alt wurde – mitgenommen hat: Es ist ein wärmendes Buch. Geistreich, humorvoll und liebenswürdig wird man von seinem Ich-Erzähler durch Regen und Traufen geführt, dabei intelligent unterhalten, auch große philosophische Fragen kommen nicht zu kurz. Es wird nichts beschönigt, das Unglück ist ein Unglück, angesichts dessen man die Güte seiner Mitmenschen besonders zu schätzen lernt. Wenn alles verloren ist, bleibt allein die Glaubenshoffnung auf ein besseres Leben im Jenseits. Und dann fügt sich alles zum Guten – gleichsam in einem Akt der Auflehnung gegen die Zumutungen der Realität wird die Geschichte einem höchst vergnüglichen Ende zugeführt.
Leben retten konnte das Buch nicht, im Polareis winzige Trostfunken fliegen lassen aber ganz bestimmt.
© Bettina Balàka
zum Nachsehen: